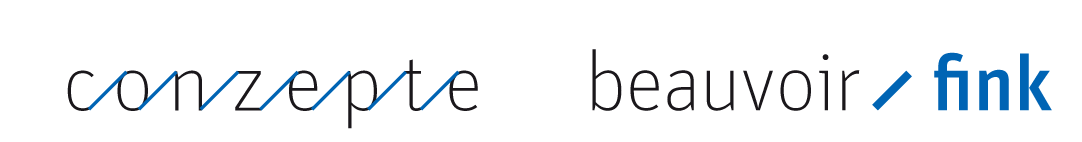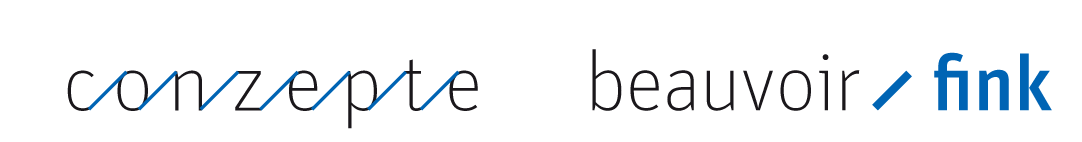Ilse Aichinger, 1948
Lilly Axster
Katherine Klinger
Conversations
Hannah Arendt, 1950
Hannah Fröhlich
Nicola Lauré al-Samarai
Conversations
Simone de Beauvoir, 1949
Dagmar Fink
Langfassung
Kurzfassung
Referenztext Beauvoir
Download
Tom Holert
Conversations
Billie Holiday, 1939
Jamika Ajalon
Rúbia Salgado
Conversations
Adrian Piper, 1983
Belinda Kazeem
Anna Kowalska
Conversations
Yvonne Rainer, 1990
Monika Bernold
Shirley Tate
Conversations
|
 Befreiend weiblich Befreiend weiblich
Dagmar Fink, 2011
„On ne naît pas femme: on le devient“ – der wohl berühmteste Satz Simone de Beauvoirs – zirkulierte im Deutschen lange als: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht“. Diese Übersetzung legt nahe, dass Weiblichkeit eine Zurichtung ist, die aus Menschen Frauen macht. Und das meint Beauvoir auch so. Doch weist die präzisere Version – „man wird es“ – zudem darauf hin, dass es Frauen nicht von Natur aus gibt und Weiblichkeit keine angeborene Qualität darstellt. Und auch das sieht Beauvoir so.
Damit ist sie anschlussfähig an queer/feministische Ansätze, die eine Natürlichkeit, Eindeutigkeit, Unveränderlichkeit und die Hierarchisierung von Geschlecht und Sexualität in Frage stellen. Mit dem Begriff der „Heteronormativität“ benennen diese Ansätze die Zweigeschlechterordnung und heterosexuelle Norm als zentrale gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Cross-Dressing, Transsexualität, weibliche Männlichkeiten, aber auch Drag Queens wurden in Folge als subversive, schillernde Geschlechterperformanzen zelebriert. Doch seltsamerweise waren es nie Weiblichkeiten, die radikal, parodistisch waren. Nicht einmal Drag Queens ließen sich unbeschwert als subversive männliche Weiblichkeiten feiern – ihnen haftete irgendwie der „Makel“ des Weiblichen an.
Verärgert über diese Ent-Wertung, habe ich mich in den letzten Jahren zunehmend mit Weiblichkeiten beschäftigt. Mein Hauptinteresse galt der Femme als Figuration queerer, also sich kritisch von der (Hetero-)Norm unterscheidender, Weiblichkeit. Sie ist nicht einfach „Femme“, also „Frau“, sondern „Femme“: ähnlich wie „Frau“ und zugleich eigenwillig anders. In ihren Selbstrepräsentationen nutzen Femmes zwar Zeichen traditioneller Weiblichkeit, sie arbeiten diese jedoch um, verschieben und resignifizieren sie. Ihr ironisches und auch lustvolles Spiel damit, „zu erscheinen wie“ und zugleich „nicht zu erscheinen wie“, destabilisiert heteronormative Erwartungen – ohne jedoch in Opposition zu Weiblichkeit zu treten. [1] Und während viele Femmes irrigerweise als Frauen gelesen werden, müssen sie nicht notwendigerweise ein weibliches Ausgangsgeschlecht haben.
Weil ich außerdem verstehen wollte, warum Weiblichkeit – paradoxerweise – auch in feministischer und queerer Theorie entwertet wird, unterzog ich Beauvoirs Das andere Geschlecht einer Relektüre. Immerhin ist dieses Buch so etwas wie ein feministischer „Urtext“. Darüber hinaus versteht Beauvoir Geschlecht als ein Werden – und nicht als Sein. Und wenn Geschlecht etwas ist, das uns nicht gegeben ist, sondern das wir erst werden, dann können wir es auch auf unterschiedliche Weise gestalten. Folglich gibt es keinen Grund, warum Weiblichkeit immer schon heteronormativ und ausschließlich patriarchales Unterdrückungsinstrument sein muss. Oder?
Wie nach ihr auch Irigaray erklärt Beauvoir, es gebe keine positive Bestimmung der Frau: Die Menschheit sei männlich und die Frau werde als das Andere des Mannes definiert, dieser jedoch nicht in Abhängigkeit von ihr. Daher erscheine der Mann als das Wesentliche, das Absolute, die Frau als das Unwesentliche. Der Mann entwerfe sich als mit schöpferischer Transzendenz gesegnetes Subjekt, als Für-sich-sein. Weiblichkeit hingegen sei gleichbedeutend mit Immanenz, dem Sein-für-ein-Anderes, und damit auch mit Reproduktion, Fürsorge, Körperlichkeit, Vergänglichkeit… Hierzu habe ich noch die unvergleichliche Nina Hagen im Ohr: „Simone de Beauvoir sagt: Gott bewahr! Und vor dem ersten Kinderschrei’n muss ich mich erstmal selbst befrei’n“. [2] Erst wenn Frauen sich als Menschen behaupten, so Beauvoir, verlieren sie die Eigenschaft des Anderen. Weiblichkeit begreift sie dementsprechend als künstlich und artifiziell, als Zurichtung und Verstümmelung. Damit analysiert sie jedoch nicht nur, in welcher Weise Weiße [3] heterosexuelle Weiblichkeit in modernen, bürgerlichen, „westlichen“ Gesellschaften konstruiert wird, sie folgt dieser Beschreibung auch und widerspricht ihr nicht. Und sie fragt gerade nicht nach den Qualitäten, die das „Frau werden“, oder vielmehr das Aneignen unterschiedlicher Weiblichkeiten für unterschiedliche Subjekte haben kann.
Bei ihren Überlegungen zu „der“ Lesbe kommt Beauvoir teilweise zu anderen Einschätzungen, dies ändert jedoch nichts an ihrer Perspektive auf Weiblichkeit. Denn selbst wenn sie lesbische oder queere Beziehungen beschreibt, setzt sie ihre heteronormative Brille nie ab. Bemerkenswert neugierig und offen beschäftigt sich Beauvoir mit unterschiedlichsten Formen von Weiblichkeiten (und weiblichen Männlichkeiten). Am Beispiel literarischer Texte (z.B. Gertrude Stein, Colette, Radclyffe Hall) zeigt sie Weiblichkeiten, die nicht in eine heteronormative Matrix passen oder sich ihr explizit widersetzen. Gleichzeitig ist sie nicht in der Lage, dabei etwas anderes als „Frau“ zu erkennen und ordnet jegliche Weiblichkeit in das Raster der Zweigeschlechterordnung ein.
Dies wird auch deutlich, wenn sie lesbischen Sex als wechselseitige Spiegelung beschreibt. Liebkose eine z.B. den Busen der anderen, spüre erstere nicht nur die Berührung, sie wisse zugleich, was die Geliebte bei der Liebkosung empfindet. Beauvoir geht also davon aus, dass es einen weiblichen Geschlechtskörper gibt, der von allen gleich erfahren wird. Doch identifizieren sich nicht alle, die einen weiblichen Geschlechtskörper haben, auch als Frauen. Darüber hinaus werden Geschlechtskörper – auch weibliche – je individuell erfahren und gelebt.
Andere gesellschaftliche Kategorisierungen, wie Rassisierung, [4] Klasse oder Ethnizität, hat Beauvoir zwar im Blick, sie betrachtet diese jedoch stets von Weiblichkeit getrennt. Die Schnittstellen, die markieren, was es bedeutet, als bürgerliche Frau oder als proletarische, als Weiße oder als Schwarze Frau in der Welt zu sein, und was das wiederum jeweils für Weiblichkeitskonzeptionen heißt – betrachtet Beauvoir nicht. Das andere Geschlecht konstruiert den einen Weiblichkeitsmythos, der ein Weißer, westlicher, bürgerlicher und heteronormativer ist. Dabei analysiert Beauvoir dessen Historizität, die Zweigeschlechterordnung behandelt sie jedoch – wider besseres Wissen – als Konstante. So gelingt es ihr nicht, unterschiedliche gesellschaftlich bestimmte wie auch kollektiv hervorgebrachte und individuell gelebte Weiblichkeitskonzepte zu erkennen. Shakira, Amy Winehouse, Marla Glen oder Johanna Dohnal – sie alle würden unter dem einen Weiblichkeitsmythos zusammengefasst, während Boy George nicht einmal als weiblich zu lesen wäre. Und eben hierin – in der Konstruktion der einen Weiblichkeit, die der Freiheit entgegensteht – liegt, wie ich an Beauvoir nur exemplarisch gezeigt habe, eine der Ursachen für die Ent-Wertung von Weiblichkeiten.
Soll Weiblichkeit nicht per se im Widerspruch zu Freiheit stehen, müssen wir den Blick auf ihre Vielfältigkeit richten: Es gilt, die ungezählten Arten und Weisen zu sehen, in denen sich Subjekte – mit der Norm und gegen sie – Weiblichkeit aneignen. Erst dann lässt sich analysieren, welche Effekte die unterschiedlichen Setzungen nicht-heteronormativer Weiblichkeiten haben. Oder anders gesagt: Erst dann können wir die Möglichkeiten an-erkennen und wertschätzen, befreiend weiblich zu werden.
/
Dagmar Fink ist Kulturwissenschafterin, Übersetzerin und Lehrbeauftragte an der Universität Wien.
Redaktion: Sabine Rohlf, Jo Schmeiser
Der Text erscheint am 19. November 2011 in der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“.
Anmerkungen
1) Siehe z.B.: http://www.das-femme-buch.de/
2) Nina Hagen, 1978, „unbeschreiblich weiblich“
3) In Anlehnung an Texte der Kritischen Weißseinsforschung schreibe ich „Weiß“ groß, um zu markieren, dass es sich dabei nicht um eine „Hautfarbe“, sondern um eine gesellschaftliche Position innerhalb eines rassistischen Kategorisierungssystems handelt.
4) Der Begriff „Rasse“ verweist im deutschsprachigen Raum unweigerlich auf den Nazismus und die Shoah. Daher gebrauche ich den Begriff der „Rassisierung“, der eine Denaturalisierung vermeintlich natürlicher bzw. biologischer Klassifizierungen bewirken will – nicht zuletzt durch seine grammatikalische Form, die ein Handeln, ein Tun impliziert – dabei jedoch den Rückbezug auf die Konstruktion „Rasse“ ermöglicht. Siehe dazu die Anmerkungen des queer-feministischen Übersetzungskollektivs gender et alia: http://www.genderetalia.net/au... |
|